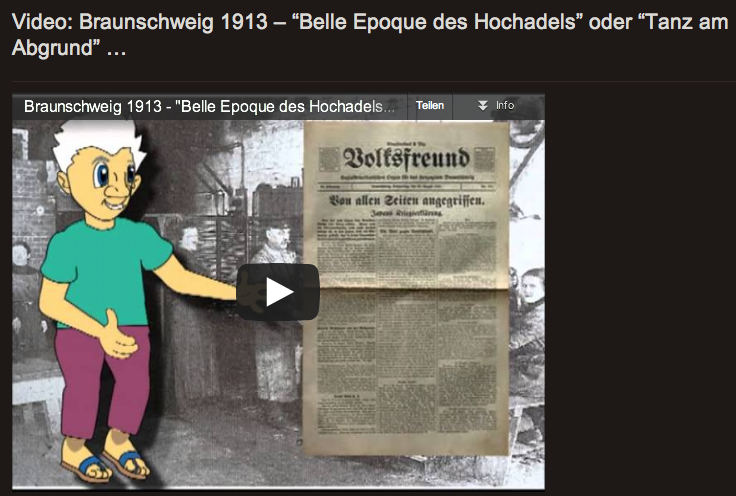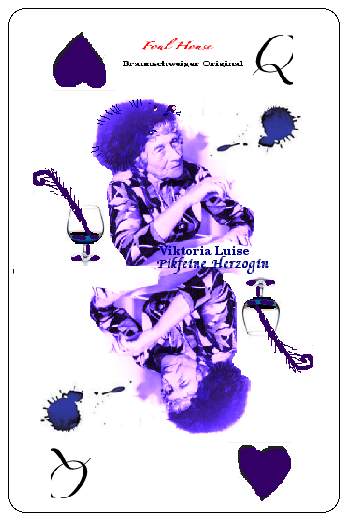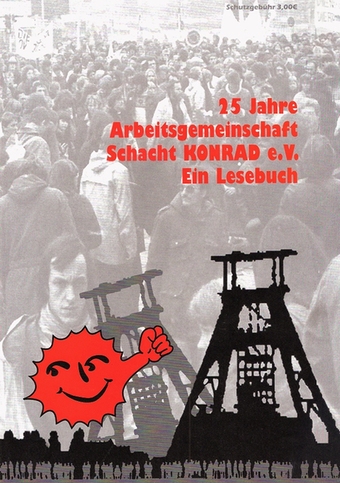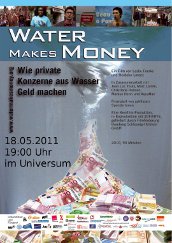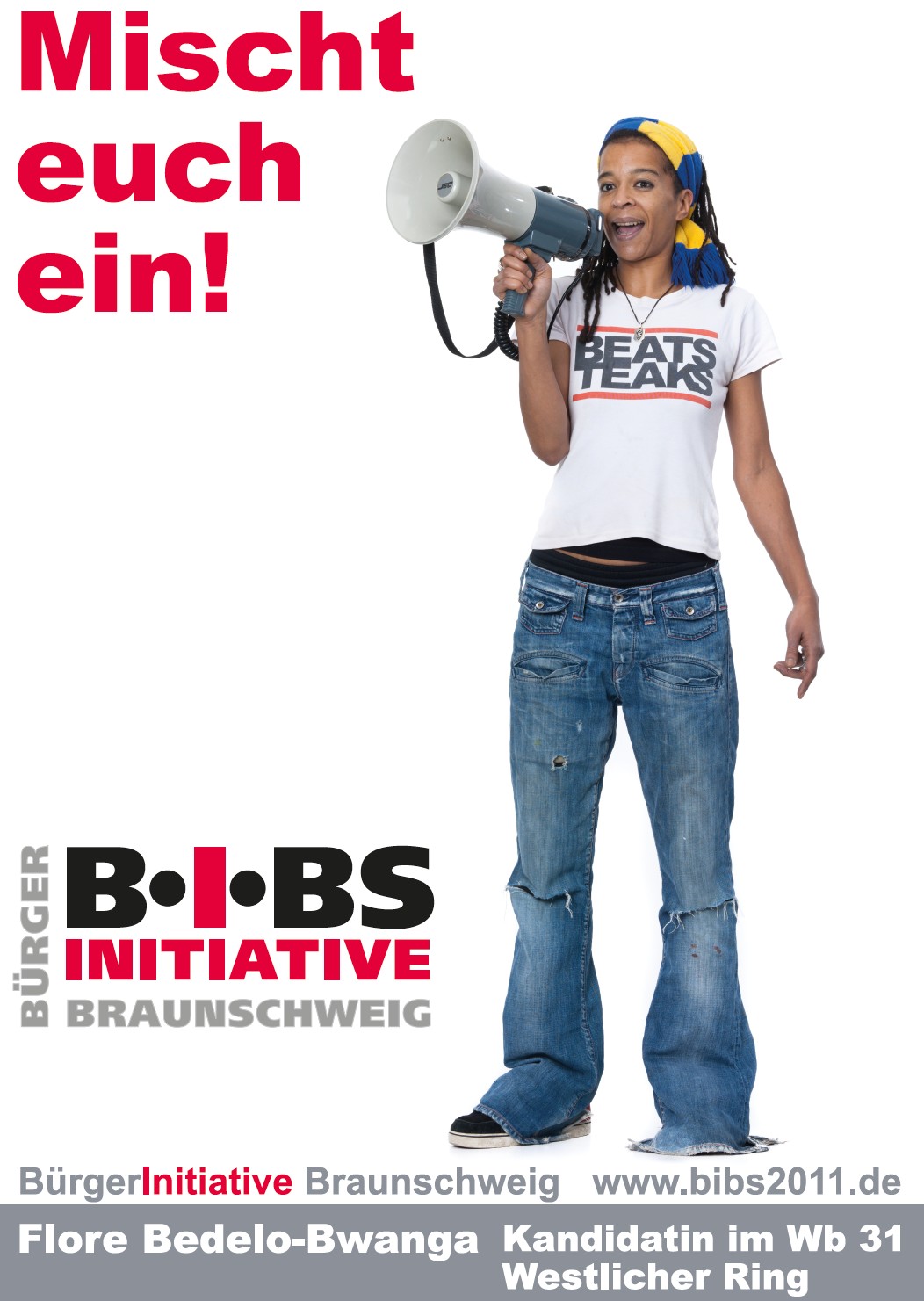Die Braunschweig Revolution 2.0(13)
Ja, wer "gute alte" Zeiten herauf beschwört...
Im Rahmen des von OB und der Stadtverwaltung vorgesehenen Adelzeremoniell zur Hochzeitsfeier Ernst-Augusts und Victoria-Luise in diesem Jahr haben sich offenbar 40 Veranstalter aus Kreisen freier Kulturträger und Kulturschaffender überlegt, wie man diesem hochherrschaftlich gedachten Spektakel mit mehr Bürgerstimme und Bürgerkultur begegnen kann und stellen damit das Ganze dahin, wo das es eigentlich hingehört:
Auf den festen Boden der Tatsachen
So wird es in der Brunsviga ein Musical geben mit dem saloppen Titel
„Hallo Vicki Lou! Braunschweig – ein Jahr vor dem Abgrund“, welches das damalige reale Leben in seinen gesellschaftlichen Widersprüchlichkeiten und sozialen Gegensätzlichkeiten samt anschließenden Diskussionsrunden aufnimmt.
Poetry Slam Hannover/Braunschweig wird es ebenfalls geben. Stefan Zeuke und Mitstreiter wollen sich mit einem Poetry-Slam-Städtewettbewerb zwischen Braunschweig und Hannover am Kulturprojekt beteiligen. Braunschweiger Poeten haben jeweils fünf Minuten Zeit, ihre Texte über Hannover vorzutragen und umgekehrt. Über die Sieger entscheidet das Publikum.
"Vier Tage im Mai"
Gilbert Holzgang vom Theater "Zeitraum" wird eine musikalische Collage erstellen, in der fünf Arbeiterinnen und Arbeiter Konserven, Mummeflaschen und Souvenirs bekleben und sich während ihrer Tätigkeit über politische und kulturelle Tagesereignisse und ihre persönlichen Sehnsüchte austauschen. Dazu gibt es Lieder aus Operetten und Varietés sowie Textmaterial aus Pressemitteilungen, Tagebüchern und Briefen.

Man kann sich hier leicht vorstellen, welche Widersprüchlichkeiten da ergeben werden, wenn romantische Schmachtgesänge auf Lebenswirklichkeit treffen.
Zur damaligen Lebenswirklichkeit könnten uns auch
Bauten der Gründerzeit Aufschluss geben, zeugen sie ja doch von Wohn- und Lebensverhältnissen der damaligen Menschen.
In der Publikation „Bauten der Gründerzeit in Braunschweig“ will der Ingenieur Elmar Arnhold aus Sicht der Architektur die Zeit des Wilhelminismus veranschaulichen.
Hier bleibt zu hoffen, dass man auch die Wohnverhältnisse der Mehrheit der damaligen Braunschweiger Menschen im Auge behält und uns nicht nur Villen, Verwaltung und Prunkbauten vorführt.
Mietskasernierung
, 1 Zimmer mit Betten und Herd für bis zu 6 Personen, 1 Waschbecken auf dem Flur und Außenklo oder Klo auf halber Treppe gehören ebenfalls dazu.
"Der Erste Weltkrieg und die Folgen"
Das Friedenszentrum beleuchtet unter anderem die Leiden der Menschen im Ersten Weltkrieg beleuchten, den Frieden ohne Sieger und Besiegte. Zudem sollen die Anfänge von Versöhnungs- und Friedenspolitik thematisiert werden.

Wie wir daran sehen können, will sich die Braunschweiger Bevölkerung nicht unbedingt an die Rathäusliche Doktrine "Nur 1913 und vom Krieg wird nichts gesagt!" halten.
Zur Lage von Wirtschaft und sozialen Bedingungen gehört zweifelsfrei auch die Zeit der Auswanderung, um der politischen Enge Europas zu entfliehen, Chancengleichheit zu suchen und neue Lebensmöglichkeit.
Ruth Fischer, Jan-Heie Erchinger und Tilman Thiemig wollen in einer Musikcollage (Jazz, Originaltexte) Braunschweiger Auswanderer bei ihrem „
Aufbruch in eine neue Welt“ nach Amerika (Louisiana) begleiten.
Victoria Luise steht in der Inszenierung für Tradition und die Werte der alten Welt, Louisiana für die Moderne.
Entgegen dem Wunsch, sich doch beim angesagten Event eher auf den Braunschweiger, den Herzog Ernst-August zu konzentrieren, zeigt das Tanztheater Kunas Modernus unter Regie Gerda Brodmann-Raudonikis den Auf- und Zusammenbruch von „Gloria Victoria! - Märchengestalt und reale Person.“ Die Herzogin wird getanzt von Jana Ritzen.
Die
Jugendkunstschule buntich will das Thema für Schüler aufbereiten und künstlerische Aktivitäten anbieten (Workshops, (Ferienprojekte, Projekttage für Schulklassen, Museumsbesuche und eine eigene Ausstellung).
(Infoquelle:
Braunschweiger Zeitung
)
Bisher eine ziemlich gute Anzahl von ins echte Licht gerückten Projekten, wie ich finde. Da kann man ja nicht mit Lob sparen. Und da muss auch der OBerbefehlshaber von "1913" was dazu erwähnen:
“Auch Oberbürgermeister Gert Hoffmann dankte den vielen Kultureinrichtungen, die engagiert, kreativ und kompetent eigene Ideen und Beiträge umsetzten." (
BZ
)
Und...
"dass ein Projekt so viele Pfeiler hat, auf denen es ruht. Dass das hier bei uns möglich ist, ist
auch hervorragende Werbung für unsere Stadt.“

Wieso hier das Wörtchen "auch"?
Kennt er seine Braunschweiger etwa nicht?
Er stellt sich ja hier selbst als der Ungläubigste aller Thomaschöre dar, der Herr Hoffmann.
Hat er nun etwa selbst intuitiv begriffen, wo er eigentlich Oberbürgermeister geworden ist?
Dämmert ihm etwa allmählich, dass die breite Kulturlandschaft Braunschweigs wirklich vorhanden, viel kreativer, kompetenter und auch engagierter ist, als er es selbst je für möglich gehalten hat?
Sieht er denn jetzt, dass es gar nicht notwendig ist, Braunschweigs Image an überkommene staubige Adelsprädikate und Biedermannuntertänigkeit zu knüpfen, so, als gäbe es sonst nichts zu vermelden?
Wenn das Engagement für die Moderne mit sachlichem realitätsnahen Blick der Braunschweiger Bürger und Kulturschaffenden den konservativ-revisionistisch veranlagten Oberbürgermeister überzeugen kann, dass er nicht FÜR uns was zu unternehmen gedenkt, sondern eher MIT uns PR, Kultur und Events für Braunschweig gestaltet, dann wäre das Thema "Monarchie und Moderne" ja endlich die Aufklärung, die unser Mann im Elfenbeinrathausturm endlich mal gebraucht hat.
Die Moderne hätte damit echt gute Chancen,
endlich Einzug zu halten im OBerstübchen...
sieht
Ulensp!egel