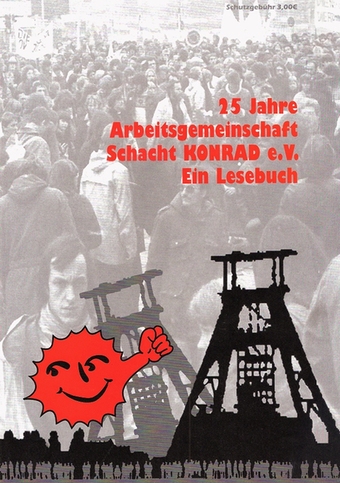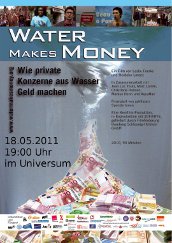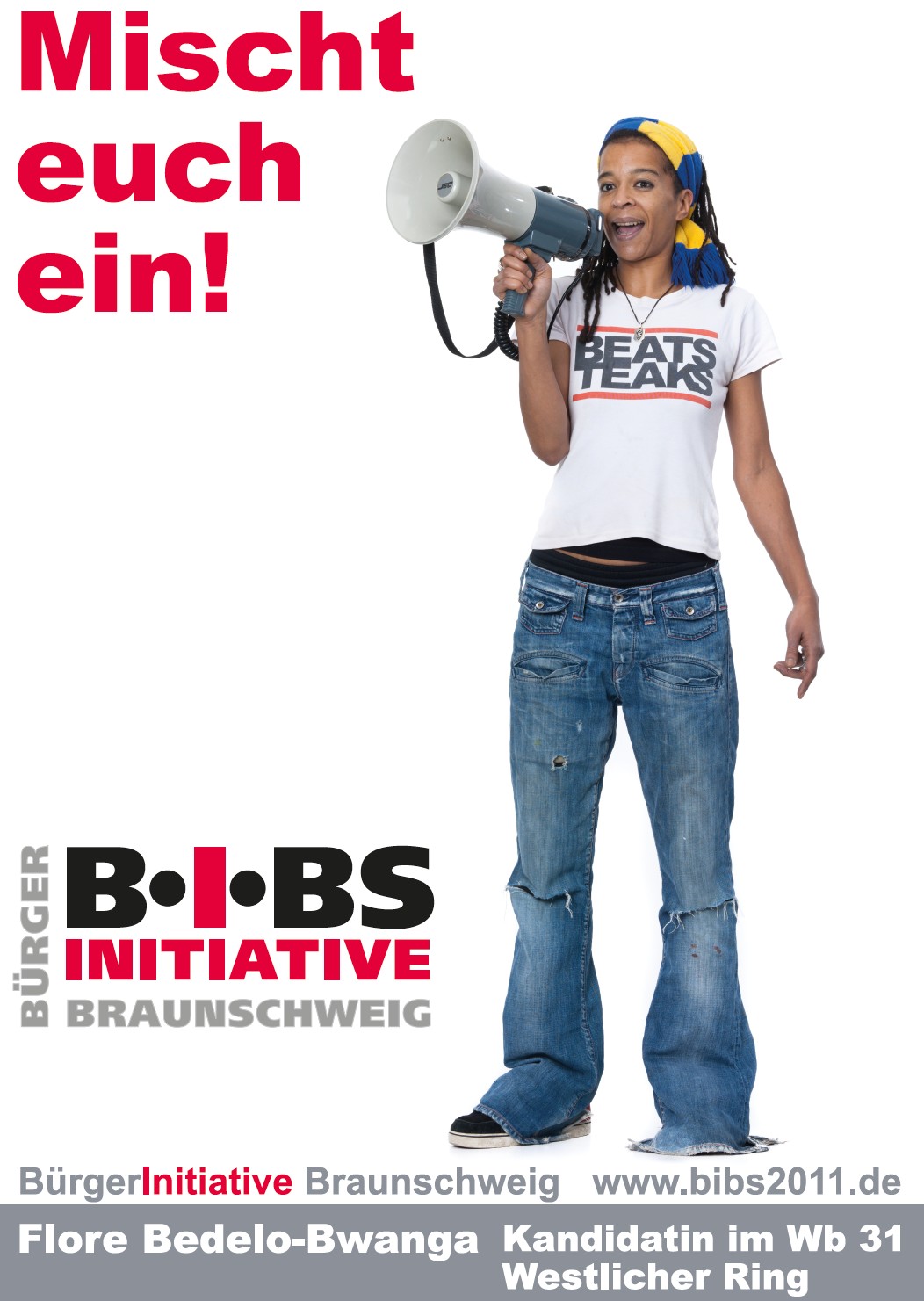Hallo Sonnenschein,
aus der Google Karte von Dir erschließt sich u.a. auch folgender Artikel aus dem Jahr 2006 (hinter einem der "Vulkan"- Symbole verborgen):
Erdbeben in Niedersachsen durch Gasgewinnung -und vielleicht demnächst sogar verstärkt durch Fracking? Das ist wirklich keine gute Nachricht.
Hier der Artikel der FAZ:
" Rätselhafte Erdbeben in Norddeutschland
04.04.2006 · Unter den Seismologen ist eine Diskussion wiederbelebt worden, die schon vor dreißig Jahren geführt wurde: Können die seltenen deutlich spürbaren Erdbeben in der Norddeutschen Tiefebene durch die dortige Erdgasförderung beeinflußt oder gar von ihr ausgelöst werden?
Von Horst Rademacher
Unter den Seismologen ist eine Diskussion wiederbelebt worden, die schon vor dreißig Jahren - wenngleich damals ohne Ergebnis - geführt wurde. Ist es möglich, so fragen einige Forscher, daß die seltenen deutlich spürbaren Erdbeben in der Norddeutschen Tiefebene durch die dortige Erdgasförderung beeinflußt oder gar von ihr ausgelöst werden? Auch jetzt ist keine einheitliche Antwort zu erkennen.
Schon seit langem bekommen die Einwohner des Ruhrgebietes die Folgen des Steinkohlebergbaus unter Tage auch an der Oberfläche zu spüren. Bergsenkungen und gelegentliche kleine Erdstöße sind nämlich die unweigerliche Konsequenz des Abbaus aller in Flözen vorkommenden Rohstoffe wie Kohle, Stein- oder Kalisalz. Beim untertägigen Bergbau entstehen Hohlräume. Wenn sie nach dem Abbau zusammenfallen, sinkt das Gestein darüber nach. Immer wieder vollziehen sich diese Einbrüche ruckartig, und Gebirgsschläge, die an der Erdoberfläche wie kleine Beben verspürt werden, sind die Folge. Das schwerste dieser sogenannten Einsturzbeben in Deutschland hatte eine Magnitude von 5,7 und ereignete sich im Jahre 1978 in den Kaligruben um Völkershausen im Werratal. Auch mechanische Spannungen im umgebenden Gestein, die wiederum Beben auslösen können, werden verursacht.
Keine eigenständigen unterirdischen Schichten
Anders als Kohle und Salz bilden Erdöl und Erdgas keine eigenständigen unterirdischen Schichten. Die Kohlenwasserstoffe sind vielmehr in den Poren eines Speichergesteins gefangen - ähnlich wie Wasser in einem Schwamm. In der Regel bleibt bei der Förderung von Öl oder Gas die Standfestigkeit des Gesteins erhalten, es kommt aber dennoch innerhalb der „höffigen“ Schicht zu einem Ausgleich des Drucks in den Gesteinsporen. Auch das führt zu Änderungen des großräumigen mechanischen Spannungsfeldes im Gebirge, die alte Bruchflächen wieder aufreißen können. Bisher hatte man geglaubt, daß in Norddeutschland die Energie dieser Spannungen nicht ausreicht, sogenannte induzierte Erdbeben mit Magnituden von mehr als 3 auszulösen.
In der Norddeutschen Tiefebene, einem weit von jeder Plattengrenze entfernt liegenden und als tektonisch besonders ruhig geltenden Gebiet, kommen gelegentlich trotzdem stärkere Erschütterungen vor. So bebte es beispielsweise am 2. Juni 1977 in der Nähe von Soltau mit einer Magnitude von 4. Am 20. Oktober 2004 ereignete sich unter dem Westrand der Lüneburger Heide ein Beben der Magnitude 4,5, das selbst in Hamburg, Hannover und Bremen deutlich verspürt wurde. Schließlich vibrierte die Erde im vergangenen Juli unter Syke bei Bremen mit einer Magnitude von 3,8. Diese Erdstöße sind zwar selbst im Vergleich mit Beben auf der Schwäbischen Alb oder in der Niederrheinischen Bucht moderat. Aber gerade weil es in Norddeutschland keine große Verwerfung oder Subduktionszone gibt, ist die Suche nach ihren Quellen geowissenschaftlich interessant.
Ist die Salztektonik die Ursache?
Mehrere Ursachen kommen in Betracht. Eine von ihnen liegt darin begründet, daß sich die tektonischen Großplatten ähnlich spröde wie Glas verhalten. Da an ihren Rändern enorme Kräfte wirken, kann ihr Inneres unter starken mechanischen Spannungen stehen. Wenn sich diese entlang alter geologischer Verwerfungslinien konzentrieren, sind „Intraplatten-Beben“ die mögliche Folge. Aber auch Ausgleichsbewegungen, die von der letzten Eiszeit herrühren, können in Norddeutschland mechanische Spannungen erzeugen. Als der Eispanzer, der damals die Gegend bedeckte, anfing zu schmelzen, begann die Erdkruste sich wieder langsam zu heben. Dieser Vorgang ist bis heute nicht abgeschlossen.
Eine weitere mögliche Ursache für die Erschütterungen ist die sogenannte Salztektonik. Im Gegensatz zu den meisten Gesteinen ist Salz nicht starr, sondern fließfähig. Obwohl es sich extrem langsam bewegt, bleibt seine Bewegung nicht ohne Einfluß auf die unmittelbare Umgebung: Eine aufquellende Salzmasse übt Druck auf das dortige Gestein aus. Wenn er dessen Bruchfestigkeit übersteigt, entstehen Erdbeben. Schließlich gibt es in Norddeutschland auch natürliche Einsturzbeben. In der Nähe von Hamburg ist ein Gipshut eines nahe an die Oberfläche reichenden Salzstockes dem Grundwasser ausgesetzt, das den Gips auflöst und wegspült. Dabei bildet sich ein unterirdischer Hohlraum, in den gelegentlich Erde einbricht.
Herdtiefe von fünf bis sechs Kilometern
Schon nach dem Beben von Soltau im Jahre 1977 wurde gelegentlich darüber diskutiert, ob die Gasförderung dabei eine Rolle gespielt haben könnte. Schließlich war die Erdgasförderung in Deutschland zu Beginn der siebziger Jahre stark angestiegen und hatte etwa 1975 erstmals eine Menge von mehr als zwanzig Milliarden Kubikmetern erreicht. Der Herd des Bebens lag aber unterhalb von sieben Kilometer Tiefe und damit unter den gasführenden Schichten. Für das „Heidebeben“ vom Oktober 2004 ermittelte Günter Leydecker von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover eine Herdtiefe von zehn bis zwölf Kilometern, also ebenfalls eine Lage im kristallinen Grundgebirge weit unterhalb der Gaslagerstätten. Er berechnete die Tiefe aus der Größe jenes Gebietes an der Erdoberfläche, in dem das Beben gespürt wurde.
In einem Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft in Bremen hat Klaus Klinge vom ebenfalls zur BGR gehörenden Seismologischen Zentralobservatorium Gräfenberg jüngst eine Reihe von wissenschaftlichen Indizien vorgestellt, die für einen wesentlich flacheren Herd des Erdbebens vom Oktober 2004 sprechen. So berechneten drei Forschergruppen unabhängig voneinander mit unterschiedlichen Verfahren den sogenannten Momente-Tensor des Bebens. Übereinstimmend ergab sich dabei eine Tiefe von fünf bis sieben Kilometern. Der Vergleich von Aufzeichnungen der Erdbebenstationen des Deutschen Regionalnetzes sowie einer äußerst empfindlichen seismischen Antenne in Kanada mit „theoretischen Seismogrammen“ lieferte ebenfalls eine Herdtiefe von nur fünf bis sechs Kilometern. An den Berechnungen waren neben Klinge auch Wissenschaftler vom Geoforschungszentrum in Potsdam, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich sowie der Universitäten Hamburg und Potsdam beteiligt.
Läßt die Gasförderung Norddeutschland erzittern?
Unterschiedliche Auffassungen über die Tiefe eines Bebenherdes sind in der seismischen Forschung völlig normal. Doch wenn der Herd der Erschütterungen vom Oktober 2004 tatsächlich in fünf bis sieben Kilometer Tiefe lag, dann hat sich das Beben in unmittelbarer Nähe oder sogar innerhalb der gasführenden Gesteinsschichten ereignet. Deshalb hat Klinge in Bremen die Frage aufgeworfen, ob die Erdgasförderung in Norddeutschland nicht auch für die Erdbeben mit Magnituden von mehr als 3 mitverantwortlich sein könnte.
Über die Wirkung seines Vortrages in der Öffentlichkeit war der Seismologe ziemlich überrascht. Schon wenig später hieß es nämlich im Internet, die Gasförderung könne Norddeutschland künftig regelmäßig erzittern lassen, und selbst von einer Gefährdung der Atommüll-Endlager im Schacht Konrad und in Gorleben war die Rede. Einen solchen Zusammenhang kann selbst Klinge nicht erkennen. In einem Gespräch mit Vertretern der erdgasfördernden Industrie wollen Wissenschaftler der BGR jetzt gleichwohl erörtern, wie man einem möglichen Einfluß der Gasförderung auf die Seismizität Norddeutschlands nachgehen kann.
Quelle: F.A.Z. vom 5.4.2006"